Horst,
der Mensch: Der verschlungene Pfad in Richtung eines Lebens zum wohl aller Wesen – Geschichte eines
europäischen Buddhisten - Stand 22.1.2020
Szene
070 – Die Bodhisattvas von Spanien - 1977
Es
war im August 1977: unsere erste Reise nach Spanien. Spanien,
insbesondere Mallorca, war seit 15 Jahren ein Traumziel der
Deutschen, nicht so für mich.
Denn
Spanien war seit 40 Jahren eine Diktatur. Die faschistische
Falange-Bewegung hatte 1936 gegen die  gewählte Regierung Spaniens
geputscht und in einem äußerst grausamen Bürgerkrieg dank der
Luftunterstützung von Hitler, der hier seine Luftwaffe für den
kommenden Weltkrieg testen konnte, die Verteidiger der Republik
besiegt. Anders als die faschistischen Regierungen in Italien und
Deutschland fegte der 2. Weltkrieg aber die rechtsradikale Diktatur
in Spanien nicht hinweg. Der Generalissimus der Putschisten, Franco
(Bild), blieb Diktator bis zu seinem Tode 1975. Für danach hatte
Franco die
gewählte Regierung Spaniens
geputscht und in einem äußerst grausamen Bürgerkrieg dank der
Luftunterstützung von Hitler, der hier seine Luftwaffe für den
kommenden Weltkrieg testen konnte, die Verteidiger der Republik
besiegt. Anders als die faschistischen Regierungen in Italien und
Deutschland fegte der 2. Weltkrieg aber die rechtsradikale Diktatur
in Spanien nicht hinweg. Der Generalissimus der Putschisten, Franco
(Bild), blieb Diktator bis zu seinem Tode 1975. Für danach hatte
Franco die Rückkehr zur Monarchie vorgesehen, wohl in der Hoffnung,
der Thronfolger des Hauses der Bourbonen würde in seinem Sinne die
Regierungsgeschäfte weiterführen. Doch unter dem neuen Monarchen
Juan Carlos (rechts, neben Franco, 1975) kehrte Spanien zur
Demokratie zurück. Das geschah 1975. Also war es soweit: 1977 konnte
ich meinen Boykott der iberischen Halbinsel beenden.
Rückkehr zur Monarchie vorgesehen, wohl in der Hoffnung,
der Thronfolger des Hauses der Bourbonen würde in seinem Sinne die
Regierungsgeschäfte weiterführen. Doch unter dem neuen Monarchen
Juan Carlos (rechts, neben Franco, 1975) kehrte Spanien zur
Demokratie zurück. Das geschah 1975. Also war es soweit: 1977 konnte
ich meinen Boykott der iberischen Halbinsel beenden.
 Das
Carstle, mein VW-Campingbus (hier mit Steffi auf der Hinfahrt in
Piney, Frankreich), brachte uns nach Spanien. Ich hatte gerade meine
Refrendarzeit an den Beruflichen Schulen in Hanau abgeschlossen und
sollte nach den Sommerferien eine Stelle an den Beruflichen Schulen
in Gelnhausen antreten, der erste Schultag war der 6. September. Ich
war inzwischen mit Eleonore verheiratet, und wir hatten zwei kleine
Töchter, Kohlrübchen, die in diesem Urlaub ihren zweiten Geburtstag
feierte, und Steffi, die während des Urlaubs ihr erstes Lebensjahr
vollendete. Wir fuhren mit dem Carstle quer durch Frankreich und dann
über die Pyrenäen – durch Andorra – nach Spanien.
Das
Carstle, mein VW-Campingbus (hier mit Steffi auf der Hinfahrt in
Piney, Frankreich), brachte uns nach Spanien. Ich hatte gerade meine
Refrendarzeit an den Beruflichen Schulen in Hanau abgeschlossen und
sollte nach den Sommerferien eine Stelle an den Beruflichen Schulen
in Gelnhausen antreten, der erste Schultag war der 6. September. Ich
war inzwischen mit Eleonore verheiratet, und wir hatten zwei kleine
Töchter, Kohlrübchen, die in diesem Urlaub ihren zweiten Geburtstag
feierte, und Steffi, die während des Urlaubs ihr erstes Lebensjahr
vollendete. Wir fuhren mit dem Carstle quer durch Frankreich und dann
über die Pyrenäen – durch Andorra – nach Spanien.
Wir
hatten ein kleines Iglu-Zelt dabei, in dem im Normalfall ich mit dem
Baby schlafen sollte, während Eli und Kohlrübchen im Carstle
übernachten sollten. Doch schon in den Pyrenäen stieß das Konzept
an seine Grenzen. Am Tag war es sehr heiß, und dann hatten wir in
der Nacht ein heftiges Gewitter. Ich erwachte und stellte fest, dass
das Baby, Steffi, mit dem Kopf zwischen die Luftmatratzen gerutscht
war. Ich bemerkte, dass das Kind (wie ich annahm) infolge der Schwüle
klatschnass geschwitzt war, sein Kopf war tropfnass.
Als
ich am Morgen wieder erwachte, sah ich, dass sich das Baby nach oben
und unten bewegte, obwohl es schlief – merkwürdig! Ich richtete
mich auf und ging der Sache auf den Grund. Nicht nur das Baby bewegte
sich auf und ab, sondern mit ihm die ganze Luftmatratze! Jetzt
verstand ich: infolge des Regens stand das Wasser 5 cm hoch im Zelt,
und die Luftmatratze, auf der das Baby schlief, schwamm hin und her.
Meine eigene Luftmatatze hingegen nicht, da ich sehr viel schwerer
war als das Baby. Und das bedeutete, dass das Kind in der Nacht nicht
nassgeschwitzt war, sondern dass es mit dem Kopf zwischen den
Luftmatratzen im Wasser lag. Es hätte glatt ertrinken können!
Damit
war der Versuch mit dem Zelt beendet. Den Rest des Urlaubs schliefen
wir zusammen im Carstle – auf einer gerade einmal 120 cm breiten
Fläche. Aber es ging, die meisten Familien hatten die meiste Zeit in
den vergangenen 10.000 Jahren auch nicht mehr Platz.
Die
erste Großstadt, die wir erreichten, war Zaragoza. Hier wechselten wir Geld. Das klingt heute sehr
normal, aber so war es damals, weit ab von touristischen Gefilden,
keineswegs. Zunächst einmal: Es wurde wirklich Geld gewechselt. Man
legte ausländische Banknoten (in diesem Falle Deutsche Mark) hin und
erhielt inländische, hier also spanische Peseten. Für eine Mark
bekam man etwa 40 Peseten. Ich betrat also die Bank, äußerte meine
Wunsch – Eli, die gut französisch und etwas kastillisch sprach,
übersetzte. Dann reichte ich dem Bankbeamten eine Banknote – nur
eine, es war eine 500-DM-Note. Er holte seine Tabelle hervor, und
rechnete – dann stutzte er, rechnete erneut, sah diese
fremdländische Banknote mit völligem Befremden an. Er griff zum
Telefon, um sich bei der Zentralbank zu erkundigen. Die telefonische
Bestätigung: ja, tatsächlich, das gäbe es, es gäbe
500-Mark-Scheine. Es war für einen einfachen Bankangestellten in
einer mittleren spanischen Großstadt damals einfach völlig
unverständlich, dass es irgendwo Banknoten von so hohem Wert geben
könnte. Damals zahlte man in einer Gaststätte im Landesineren –
also nicht in Touristissinien, sondern im wirklichen Spanien – 20
Pfennig für ein Bier oder eine Cola. Und dazu bekam man noch
kostenlose Tapas, kleine Leckerbissen, zum Dank für den Auftrag.
Andererseits erscheint es uns heute für die Echtheitsprüfung von
Banknoten doch sehr befremdlich, einfach einmal bei der vorgesetzten
Behörde nachzufragen, ob es diese Stückelung gäbe – und das,
ohne zu wissen, wie sie denn möglicherweise aussehen könnte. -
Übrigens, so:
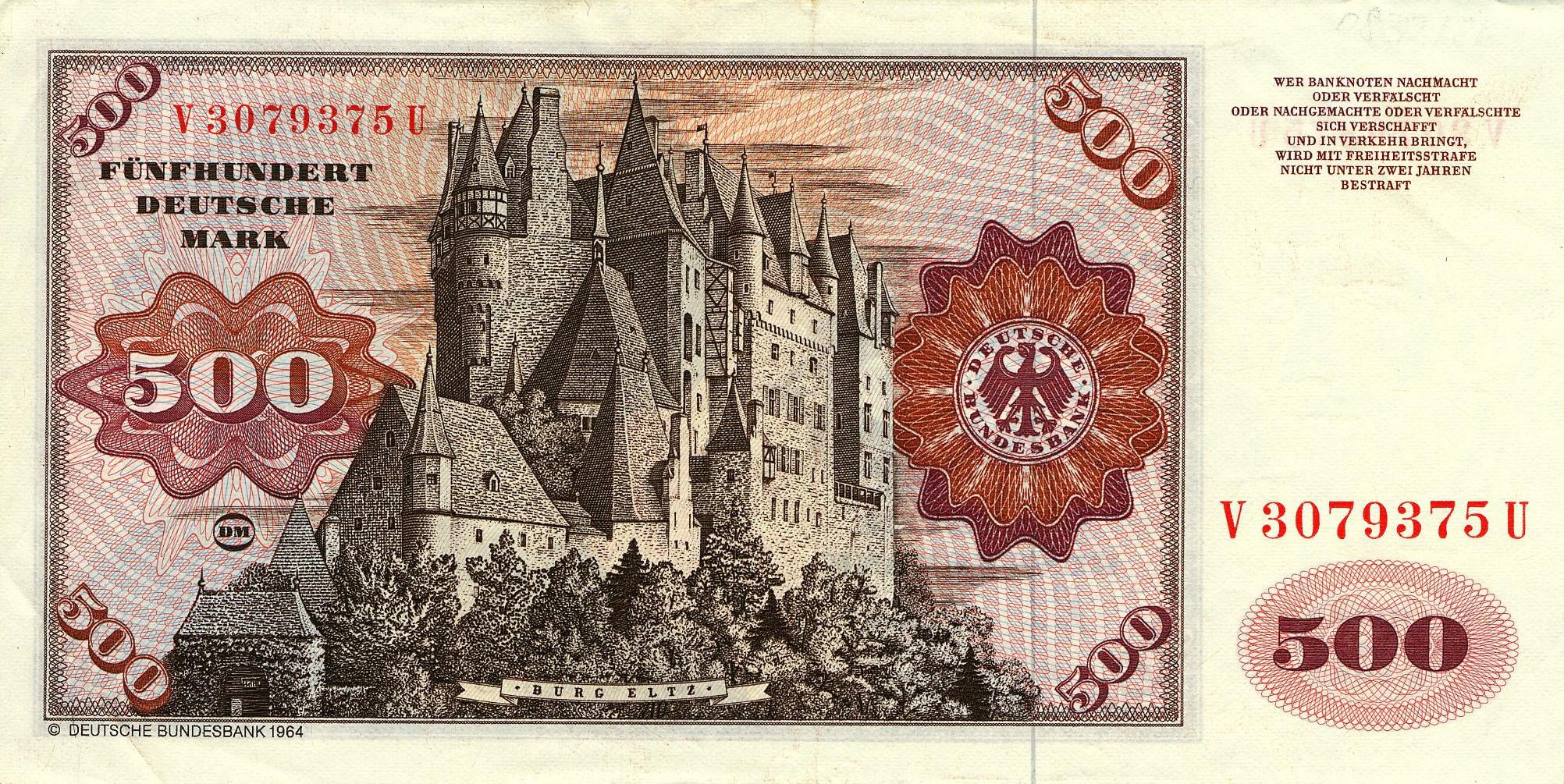
Wir
waren die meiste Zeit auf dieser Reise im Landesinneren. Wir kamen
durch Dörfer ohne fließend Wasser und ohne Strom, begegneten
Eselskarawanen und sahen Berge, in denen die Menschen noch in Höhlen
lebten. Der größte Teil des Landes war jedoch sehr trocken. Früher
gab es hier reiche Landwirtschaft, überall waren terrassierte
Berge, dort wurde früher Ackerbau betrieben. Jedoch waren für die
spanische Armada alle Wälder abgeholzt worden, also sank die
Verdunstung, dadurch gingen die Niederschläge zurück, infolge
dessen rentierte sich die Landwirtschaft nicht mehr, und die Spanier
mussten, nachdem sie auf diese Art ihr eigenes Land ruiniert hatten,
nach Lateinamerika auswandern. Dort versucht man jetzt
auszuprobieren, ob durch die Abholzung der Urwäldern der gleiche
Effekt wieder eintritt – oder ob das Gesetz von Ursache und Wirkung
vielleicht nicht mehr gültig ist. Ich halte den Ausgang dieses
Versuchs für absehbar.
Eigentlich
wollte ich jedoch mit diesem Artikel auf ein ganz anderes Thema
heraus, und das spielte sich am Ende unserer Reise ab. Diese
Sommertour war nämlich etwas anders angelegt, als unsere üblichen
Reisen mit Campingbus und Wohnmobil. Normalerweise fuhren wir sechs
Wochen durch eine europäische Region – z. B. die iberische
Halb-insel – um diese zu erkunden. Diesmal jedoch hatten wir uns
mit anderen Leuten verabredet, die letzten zwei Wochen gemeinsam
einen recht konventionellen Urlaub zu machen. Daher hatten wir unser
Rundfahrtprogramm gekürzt – Portugal wurde gestrichen – und zum
Schluss hatten wir uns mit Elis  Schwester Ernestine (Bild, in
Begleitung von deren Sohn, der so alt war wie Kohlrübchen), ihrer
Freundin Regine und deren Mann Berthold verabredet. Wir hatten
zusammen ein Bungalow 100 km südlich von Barcelona an der Küste
gemietet.
Schwester Ernestine (Bild, in
Begleitung von deren Sohn, der so alt war wie Kohlrübchen), ihrer
Freundin Regine und deren Mann Berthold verabredet. Wir hatten
zusammen ein Bungalow 100 km südlich von Barcelona an der Küste
gemietet.
Das
war eine recht konventionelle Urlaubszeit von jungen Familien am
Strand. Allerdings wurde die Idylle von zwei Ereignissen
überschattet, die unsere Familie – aber nicht die unserer
Bekannten - direkt betrafen. Steffi, das Baby, das gerade ein Jahr
alt geworden war, wurde sehr krank, sie hatte heftigen Durchfall. Nun
ist Durchfall normalerweise nichts Tragisches, er kommt, er geht -
und er ist ärgerlich. Diesmal war es aber anders, offensichtlich war
das Magen–Darm-System des Babys heftig angegriffen: wenn Steffi
(auf dem Bild links, neben Kohlrübchen) den Boden entlang
krabbelte, blutete sie aus dem After und eine feine Blutspur folgte
ihr. Ich war entsetzt. Wir überlegten, was zu tun sei. Spanien war
damals auf einem Entwicklungsstandard wie heute afrikanische Länder.
Hier eine kompetente medizinische Versorgung zu erwarten, schien
höchst vermessen. Andererseits: wo dann? In Südfrankreich? Ich war
skeptisch. Wir entschlossen uns, einen Versuch hier vor Ort zu
starten, um medizinische Hilfe zu bekommen. Gleichzeitig bereiteten
wir unseren Aufbruch vor – fast konnte man schon sagen: unsere
Flucht. Wir wollten so schnell wie möglich zurück in die
Zivilisation kommen. Nach den damaligen Verhältnissen – und
unseren Ansichten – war die nächste verlässliche Gegend die
Schweiz. Die war (auf Landstraßen) in 16 Stunden erreichbar.
des Babys heftig angegriffen: wenn Steffi
(auf dem Bild links, neben Kohlrübchen) den Boden entlang
krabbelte, blutete sie aus dem After und eine feine Blutspur folgte
ihr. Ich war entsetzt. Wir überlegten, was zu tun sei. Spanien war
damals auf einem Entwicklungsstandard wie heute afrikanische Länder.
Hier eine kompetente medizinische Versorgung zu erwarten, schien
höchst vermessen. Andererseits: wo dann? In Südfrankreich? Ich war
skeptisch. Wir entschlossen uns, einen Versuch hier vor Ort zu
starten, um medizinische Hilfe zu bekommen. Gleichzeitig bereiteten
wir unseren Aufbruch vor – fast konnte man schon sagen: unsere
Flucht. Wir wollten so schnell wie möglich zurück in die
Zivilisation kommen. Nach den damaligen Verhältnissen – und
unseren Ansichten – war die nächste verlässliche Gegend die
Schweiz. Die war (auf Landstraßen) in 16 Stunden erreichbar.
Aber
zunächst unternahmen wir einen Versuch im nahem Städtchen Calpe.
Eli fragt auf der Straße Leute nach einem Arzt. Man empfiehlt ihr
einen. Sie erkundigt sich: „Kinderarzt?“ Die Antwort: „Nix
Kinderarzt – guter Arzt.“ Die Einrichtung eines speziellen
Kinderarztes schien hier noch unbekannt zu sein. Die Praxis des
Arztes war in einem Obergeschoss eines Wohnsblockes. Wir gehen
dorthin, klingeln. Niemand öffnet. Andererseits: es ist noch
Mittagszeit. Siesta. Wir warten. Irgendwann kommt noch jemand. Er
riecht nach Bier und Tabak, unrassiert, trägt trotz des Sommers
einen alten, fleckiger Mantel. Aha, ein Penner. Was will der hier?
Dieser Arzt wird doch wohl nicht so eine Kundschaft haben?!
Nein,
hat er nicht. Er ist der Arzt. Wir versuchen uns zu verständigen.
Das ist nicht einfach. Der Arzt spricht kein Englisch, kein
Französisch, natürlich nicht Deutsch, aber leider auch kein
Kastillisch (Spanisch), sondern nur Catalan. Ich versuche es mit
Latein. Leider auch Fehlanzeige. Inzwischen habe ich die beiden
einzigen medizinische Bücher, die in einem Regal standen,
inspiziert. Der Umschlag des einen ist so ausgebleicht, dass nichts
mehr zu entziffern ist. Das andere ist eine Einführung in die
Humanmedizin, erschienen 1917. Aha. Mein Vertrauen in den Arzt ist
dadurch nicht gerade gewachsen. Er geht zu einer Untersuchungsliege,
darauf liegt ein auseinander genommener Radioapparat. Er räumt ihn
zur Seite, wischt mit dem Ellbogen einen Ölfleck ab. Die
Kunstlederhülle der Auflage ist an zwei Stellen zerfetzt, fleckiges
Schaumgummi quillt heraus. Steffi wird darauf gelegt. Er berührt
ihren Bauch auf der rechten Seite und sagt etwas, das mit einer
sichtbaren Verneinung endet. Ich verstehe: er hat gerade die Diagnose
eines akuten oder geplatzten Blinddarms ausgeschlossen. Das beruhigt
mich etwas; er scheint logisch vorzugehen.
Ernestine
im Carstle mit Steffi und Kohlrübchen
Er
untersucht weiter. Dann erzählt er einiges, was wir nicht verstehen,
stellt ein Rezept aus. Und dann sucht er einige Sachen zusammen,
einen Kalender, eine Uhr, findet in seinem Schreibtisch einige
Reiskörner. Mit Gebärdensprache macht er uns klar, wann das Kind
die Arznei einnehmen muss, wie sie verabreicht werden muss, macht
deutlich, dass sich das Kind dagegen wehren wird, weil die Medizin
wohl scheußlich schmeckt, zeigt, wie man das Kind halten muss, auch
dass man ihm hinterher den Mund zuhalten muss, bis es geschluckt hat.
Erläutert, alle wie viele Stunden die Medizin zu verabreichen ist
und wann mit einer Besserung zu rechnen ist, auch dass die Medizin
für volle fünf Tage zu verabreichen ist, also auch nach dem Ende
der Beschwerden. Es ist ihm inzwischen gelungen, uns von seiner
Kompetenz zu überzeugen, jedoch: ein Rest Skepsis bleibt.
Wir
holen das Medikament. Überraschender Weise ist es nichts von anno
dazumal, sondern es handelt sich um Ampullen mit bestimmten
Bakterien. In jeder Ampulle sind 2 Mio. dieser Bakterien.
Tatsächlich, Steffi wehrt sich, mag sie nicht nehmen. Ich werde dazu
auserkoren, sie dem Kind einzuflößen, muss Steffi hinterher Mund
und Nase zuhalten, bis sie aus Verzweiflung schluckt. Insgesamt 20
Mal in 5 Tagen geschieht das. Es hat einen doppelten Effekt:
einerseits sind die heftigsten Syptome bereits nach 6 Stunden
verschwunden. Andererseits ist mir ziemlich klar, dass ich mit dieser
Art, dem Baby die Medizin zu verabreichen, erhebliche Ressentiments
gegen meine Person in Steffi aufsteigen lasse, ich fürchte, das wird
auf unsere späteren Beziehungen Auswirkungen haben. Aber es ist wohl
nötig. Leider.
Ich
versuche die anderen zu überzeugen, dass es nicht angeht, dass wir
essen, während das arme Kind, ausgehungert wie es ist, tagelang nur
Reis zu essen bekommt und sieht, wie wir leckere Sachen konsumieren
und sie davon nichts abbekommt. Leider gelingt es mir nicht, mich
damit durchzusetzen. Man stimmt mir zwar zunächst verbal zu, dann
jedoch wird anders gehandelt. Ein Muster, das sich wie einen roten
Faden durch meine Ehe zog.
Wir
mussten nicht vorzeitig aus Spanien zurück. Noch nicht. Doch dann
kam die zweite Schwierigkeit. Am 29. August, an meinem Geburtstag,
geschah es. Für diesen Tag, so war es mit meiner Mutter verabredet,
würden wir sie anrufen. Das war hier, in der touristisch besetzten
Zone Spaniens, wesentlich leichter als im Rest des Landes.
Schon
einmal, drei Wochen vorher, hatte Eli ihren Eltern einen Anruf
versprochen. Wir hatten es von Madrid aus versucht. Von dort, so
dachten wir, müsste doch ein Anruf möglich sein. Weit gefehlt.
Weder im Hauptpostamt von Madrid noch im Postministerium war es
möglich, nach Deutschland anzurufen. Drei Tage später hatte Eli
dies in einer kleinen Gaststätte in einem Dorf ohne fließend Wasser
oder gepflasterter Straße erzählt. Die Wirtin wusste, dass es im
Ort ein Telefon gab. Die Besitzerin dieses Gerätes ließ von dort
alle Einwohner des Ortes telefonieren, d. h. sie vermittelte es,
Durchwahl gab es dort damals noch nicht, und diese Frau hatte wohl
eine Marktlücke entdeckt. Als wir ihr unser Problem erläuterten,
war sie begeistert. Ein Anruf nach Deutschland, welch eine
Herausforderung! Wie das geht, würde sie herausfinden! Wir sollten
zurück in die Wirtschaft gehen, sie würde uns informieren, wenn es
möglich sei. Nicht einmal zwei Stunden später schickte sie uns
eines ihrer Kinder vorbei: wir könnte jetzt kommen, sie hätte die
Freigabe einer Leitung für in 15 Minuten über die nationale
Postzentrale durchsetzen können. Das Foto
zeigt das Dorf der Telefonistin.
erzählt. Die Wirtin wusste, dass es im
Ort ein Telefon gab. Die Besitzerin dieses Gerätes ließ von dort
alle Einwohner des Ortes telefonieren, d. h. sie vermittelte es,
Durchwahl gab es dort damals noch nicht, und diese Frau hatte wohl
eine Marktlücke entdeckt. Als wir ihr unser Problem erläuterten,
war sie begeistert. Ein Anruf nach Deutschland, welch eine
Herausforderung! Wie das geht, würde sie herausfinden! Wir sollten
zurück in die Wirtschaft gehen, sie würde uns informieren, wenn es
möglich sei. Nicht einmal zwei Stunden später schickte sie uns
eines ihrer Kinder vorbei: wir könnte jetzt kommen, sie hätte die
Freigabe einer Leitung für in 15 Minuten über die nationale
Postzentrale durchsetzen können. Das Foto
zeigt das Dorf der Telefonistin.
Aber
jetzt hier, im touristisch besetzen Teil Iberiens, war das ganz
anders. Hier gab es bereits Telefonzellen mit der Möglichkeit zur
Durchwahl! Wir hatten auch lange genug Münzen gesammelt, dass das
jetzt möglich war. Also riefen wir meine Mutter zu meinem Geburtstag
an, am Abend des 29. August. Und wir bekamen eine wichtige
Information. Ich musste nicht etwa am 6. September zu
Schuljahresbeginn in der Schule antreten, sondern mein Arbeitsvertrag
lief ab dem 1. September. An diesem Tage müsse ich in der Schule
erscheinen, um den Diensteid abzulegen.
Also
mussten wir doch vorzeitig zurück. Eigentlich nur meine Familie und
ich, aber die anderen waren entschlossen, dann auch mit zurück zu
fahren. Also wurde für den nächsten Tag, den 30.8.77 ein Putz- und
Packtag angesetzt. Am 31.8. morgens um 5 h sollte die Abfahrt sein,
damit ich am 1. Sept. um 8 h in der Schule sein konnte.
Ich
wusste gar nicht, was alles an Aufräum-, Putz- und Packarbeiten zu
erledigen sein müsste, jedenfalls wenn drei Hausfrauen unterwegs
sind. Wir waren alle den ganzen 30. August über damit beschäftigt.
Auf dem Heimweg sollte ich dann – wie üblich - das Carstle fahren,
während die anderen sich am Steuer des Käfers ablösten. Da
mindestens ein Tag und eine Nacht Fahrt vor mir lagen – für Pausen
war keine Zeit – entschloss ich mich am 30.8. früh ins Bett zu
gehen. Alllerdings war an Schlaf nicht zu denken, im ganzen Haus
wurde geräumt und gewerkelt.
Um
5 h sollte es losgehen, für 4.30 h war Wecken angesagt, um 1.30 h
floh ich aus dem Haus ins Carstle. Wie soll ich mehr als 24 Std.
hinterm Lenkrad sitzen, wenn ich nicht wenigstens ein paar Stunden
geschlafen hatte? Ich wälzte mich hin und her. Der Ärger übers
Nichtschlafenkönnen machte die Sache auch nicht besser. Es wurde 2
h, es wurde 3 h, mein Ärger, meine Verzweiflung, aber auch meine
Angst, einen Unfall zu bauen, wuchs minütlich.
Um
4.08 h kam mir eine Idee. Wenn ich nur noch 20 Min. Zeit habe, dann
bleibt nur eine einzige Möglichkeit. Ich weiß nicht an welche
Erfahrung ich dabei anknüpfte. Aber ich weiß, dass es keine
Erfahrung aus diesem Leben war. Ich setzte mich im Carstle aufrecht
hin, schob mir ein Kissen unters Gesäß, verschränkte meine Beine,
legte meine Hände auf die Knie, Daumen und Zeigefinger berührten
sich. Ich konzentrierte mich auf meinen Atem, nur zwei Atemzüge
lang, dann…
… es
war ein herrlicher Raum, wunderbar, ein unbegrenzter Raum. Himmlische
Sphärenmusik erklang. Vor mir eine Treppe: die 10 Stufen zur
Vollendung. Oben ein Thron, darauf eine Figur, die Vollkommenheit
symbolisierte. Sie sah aus wie eine Mischung zwischen dem Gottesbild,
das in der St.-Pauls-Kirche in Großauheim über dem Altar prangte
(ich hatte dort meine Erstkommunion), und einer Buddhafigur. Jede der
10 Treppenstufen war flankiert von einem wunderbaren, reich mit
Edelsteinen ausgestatteten Wesen. Engel? Möglicherweise, aber keine
geflügelten. Bodhisattvas? Das Wort kannte ich damals nicht, aber es
trifft es wohl am besten.
 Der
Bodhisattva auf der linken Seite der untersten Stufe zwinkerte mir
zu, ermutigte mich. Es ging um den ersten Schritt, den ersten Schritt
auf der Leiter zur Vollkommenheit. Ich konzentrierte mich, wusste,
dass ich nicht durch die Kraft meiner Muskeln, sondern einzig durch
die meines Geistes weiter kommen würde. Und tatsächlich: meine Füße
standen still, aber durch die Kraft der meditativen Konzentration
wurde ich wie von Geisterhand – von der Hand meines konzentrierten
Geistes – dort hochgehoben. Ein beifälliges Raunen ging durch die
Versammlung der Bodhisattvas.
Der
Bodhisattva auf der linken Seite der untersten Stufe zwinkerte mir
zu, ermutigte mich. Es ging um den ersten Schritt, den ersten Schritt
auf der Leiter zur Vollkommenheit. Ich konzentrierte mich, wusste,
dass ich nicht durch die Kraft meiner Muskeln, sondern einzig durch
die meines Geistes weiter kommen würde. Und tatsächlich: meine Füße
standen still, aber durch die Kraft der meditativen Konzentration
wurde ich wie von Geisterhand – von der Hand meines konzentrierten
Geistes – dort hochgehoben. Ein beifälliges Raunen ging durch die
Versammlung der Bodhisattvas.
Ich
hatte den ersten Schritt geschafft, hatte Anerkennung bekommen. Die Bodhisattvas raunten, ob ich denn auch den zweiten
Schritt schaffen würde…
Bodhisattvas raunten, ob ich denn auch den zweiten
Schritt schaffen würde…
Erneute
Konzentration - und erstaunlich, ich bewegte mich aufwärts,
erreichte die zweite Stufe, hielt die Konzentration, ich staunte
selbst am meisten über das, was mir da gelang, musste aber die
Konzentration halten, nur jetzt nicht nachlassen, die dritte Stufe,
beifälliges Raunen, leise Rufe des Erstaunens, die mich nur noch
mehr anfeuerten und ich stand auf der vierten Stufe des
Bodhisattva-Pfades. Gleichzeitig mit meinem Vorrücken, leuchteten
die Stufen, die ich erreicht hatte, hell auf und auch die
Illumination des Raumes wurde noch heller, strahlendes Licht erhellte
den Weltraum, und um mich auf den Stufen rechts und links strahlten
alle diese wunderbaren Bodhisattvas in den faszinierendsten Farben.
Sie schienen mich für meine Erfolge auf dem Pfad zu schätzen, zu
bewundern, sie, die doch viel voll-kommener waren als ich wohl jemals
sein werde.
Sie
sahen mich an, erwartungsvoll, gespannt. Ich konzentrierte mich, nahm
alle meine Kraft zusammen, richtete meine Augen auf den Buddha, der
auf dem Thron der 10. Ebene stand, und siehe da, es gelang mir weiter
zu kommen erneut hellere Lichter, das musste die fünfte Stufe sein.
Ich bemerkte, wie mir der Schweiß der höchsten Konzentration aus
den Poren trat, als ich die sechste Stufe erreichte. Ich war
verwundert, ob dessen, was ich erreicht hatte, und all diese
Bodhisattvas frohlockten und riefen mir Worte der Erreichung, der
Unterstützung, der Freude und der Kraft zu. Ob ich jetzt ein
Bodhisattva der sechsten Erreichung war?
Aller
Augen waren auf mich gerichtet. Ich hatte viel erreicht, aber ich
hatte auch gemerkt, wie es von Stufe zu Stufe schwerer wurde, wie
quasi übermenschliche Fähigkeiten nötig wurden. Doch nun schwiegen
alle Bodhisattvas, nur die himmlische Musik erklang weiter, aller
Augen waren auf mich gerichtet. Ich fasste alle meinem Mut zusammen,
konzentrierte mich. Nur ganz allmählich ging es vorwärts,
zentimeterweise. Ich setzte all mein Vertrauen auf die Bodhisattvas
und auf den Höchsten. Da spürte ich es unter meine Füßen. Ich
hatte Level 7 erreicht. Diesmal gab es keinen Applaus, kein
Frohlocken, nur diese Blicke, diese gespannten Blicke. Mir wurde
klar, ich kann jetzt nicht einfach aufhören und nach Hause gehen.
Man wollte wissen, wer ich bin, ob ich womöglich auch noch die achte
Erreichung schaffe.
Höchste
Konzentration ich merke wie ich langsam vorankomme, eher
milllimeterweise als zentimeterweise, Tausende Augen sind auf mich
gerichtet, nicht nur die der Bodhisattvas der Stufen, sondern auch
die von unzähligen Devas in den Weiten des Universums. Und in
diesem Moment erreiche ich die achte Stufe. Freudiges Wohlgefallen,
himmlische Spärenmusik, Licht, das mir heller als 1000 Sonnen
erscheint. Und doch das Wissen: ich kann mich jetzt nicht einfach
hinsetzen. Man erwartet von mir, dass ich mich so lange bemühe, mein
Äußerstes gebe, bis ich meine Grenzen total ausgelotet habe. Also
noch einmal, ich bemühe mich so, wie ich mich noch nie in meinem
Leben bemüht habe – und ich merke ein Vorankommen, habe ein
Viertel des Weges zur neunten Stufe erreicht, jetzt die Hälfte. Es
ist ungemein schwer die Konzentration zu halten, es geht ein wenig
weiter, dann bemerke ich Stagnation, bemühe mich nach besten
Kräften. Aber da empfinde ich es ganz deutlich: es geht langsam
abwärts. Ich komme wieder auf Stufe 8 zu stehen. - Aber es fühlt
sich nicht wie ein Misserfolg an. Das Schweigen ist zu Ende, die
Bodhisattvas reden, beglückwünschen mich, kaum ein Mensch würde es
so weit bringen. Ich bin überglücklich.
Mein
Gesicht strahlt, während die Bodhisattva-Welt verblasst. Ich sitze
im Carstle, hellwach und überglücklich. In diesem Moment der
Wecker, es ist 4.30 h. Eine halbe Stunde später bin ich unterwegs,
fahre das übervoll beladene Carstle. Auf den 100 km bis Barcelona
habe ich (Bild) auf der kurvenreichen, bergigen Küstenstraße
bereits über 100 Autos überholt, wie Berthold, der den Käfer hinter mir fährt, hinterher fluchend
erzählt. Ohne Stopp geht es nach Hause, 25 Stunden Fahrt. Ich habe
sogar noch Zeit zum Duschen, bevor ich in der Schule meine neue
Stelle antrete.
Zurück zu Der verschlungene Pfad in Richtung eines Lebens zum Wohl aller Wesen.
Zurück zur Heimatseite
 gewählte Regierung Spaniens
geputscht und in einem äußerst grausamen Bürgerkrieg dank der
Luftunterstützung von Hitler, der hier seine Luftwaffe für den
kommenden Weltkrieg testen konnte, die Verteidiger der Republik
besiegt. Anders als die faschistischen Regierungen in Italien und
Deutschland fegte der 2. Weltkrieg aber die rechtsradikale Diktatur
in Spanien nicht hinweg. Der Generalissimus der Putschisten, Franco
(Bild), blieb Diktator bis zu seinem Tode 1975. Für danach hatte
Franco die
gewählte Regierung Spaniens
geputscht und in einem äußerst grausamen Bürgerkrieg dank der
Luftunterstützung von Hitler, der hier seine Luftwaffe für den
kommenden Weltkrieg testen konnte, die Verteidiger der Republik
besiegt. Anders als die faschistischen Regierungen in Italien und
Deutschland fegte der 2. Weltkrieg aber die rechtsradikale Diktatur
in Spanien nicht hinweg. Der Generalissimus der Putschisten, Franco
(Bild), blieb Diktator bis zu seinem Tode 1975. Für danach hatte
Franco die Rückkehr zur Monarchie vorgesehen, wohl in der Hoffnung,
der Thronfolger des Hauses der Bourbonen würde in seinem Sinne die
Regierungsgeschäfte weiterführen. Doch unter dem neuen Monarchen
Juan Carlos (rechts, neben Franco, 1975) kehrte Spanien zur
Demokratie zurück. Das geschah 1975. Also war es soweit: 1977 konnte
ich meinen Boykott der iberischen Halbinsel beenden.
Rückkehr zur Monarchie vorgesehen, wohl in der Hoffnung,
der Thronfolger des Hauses der Bourbonen würde in seinem Sinne die
Regierungsgeschäfte weiterführen. Doch unter dem neuen Monarchen
Juan Carlos (rechts, neben Franco, 1975) kehrte Spanien zur
Demokratie zurück. Das geschah 1975. Also war es soweit: 1977 konnte
ich meinen Boykott der iberischen Halbinsel beenden.
 Das
Carstle, mein VW-Campingbus (hier mit Steffi auf der Hinfahrt in
Piney, Frankreich), brachte uns nach Spanien. Ich hatte gerade meine
Refrendarzeit an den Beruflichen Schulen in Hanau abgeschlossen und
sollte nach den Sommerferien eine Stelle an den Beruflichen Schulen
in Gelnhausen antreten, der erste Schultag war der 6. September. Ich
war inzwischen mit Eleonore verheiratet, und wir hatten zwei kleine
Töchter, Kohlrübchen, die in diesem Urlaub ihren zweiten Geburtstag
feierte, und Steffi, die während des Urlaubs ihr erstes Lebensjahr
vollendete. Wir fuhren mit dem Carstle quer durch Frankreich und dann
über die Pyrenäen – durch Andorra – nach Spanien.
Das
Carstle, mein VW-Campingbus (hier mit Steffi auf der Hinfahrt in
Piney, Frankreich), brachte uns nach Spanien. Ich hatte gerade meine
Refrendarzeit an den Beruflichen Schulen in Hanau abgeschlossen und
sollte nach den Sommerferien eine Stelle an den Beruflichen Schulen
in Gelnhausen antreten, der erste Schultag war der 6. September. Ich
war inzwischen mit Eleonore verheiratet, und wir hatten zwei kleine
Töchter, Kohlrübchen, die in diesem Urlaub ihren zweiten Geburtstag
feierte, und Steffi, die während des Urlaubs ihr erstes Lebensjahr
vollendete. Wir fuhren mit dem Carstle quer durch Frankreich und dann
über die Pyrenäen – durch Andorra – nach Spanien.
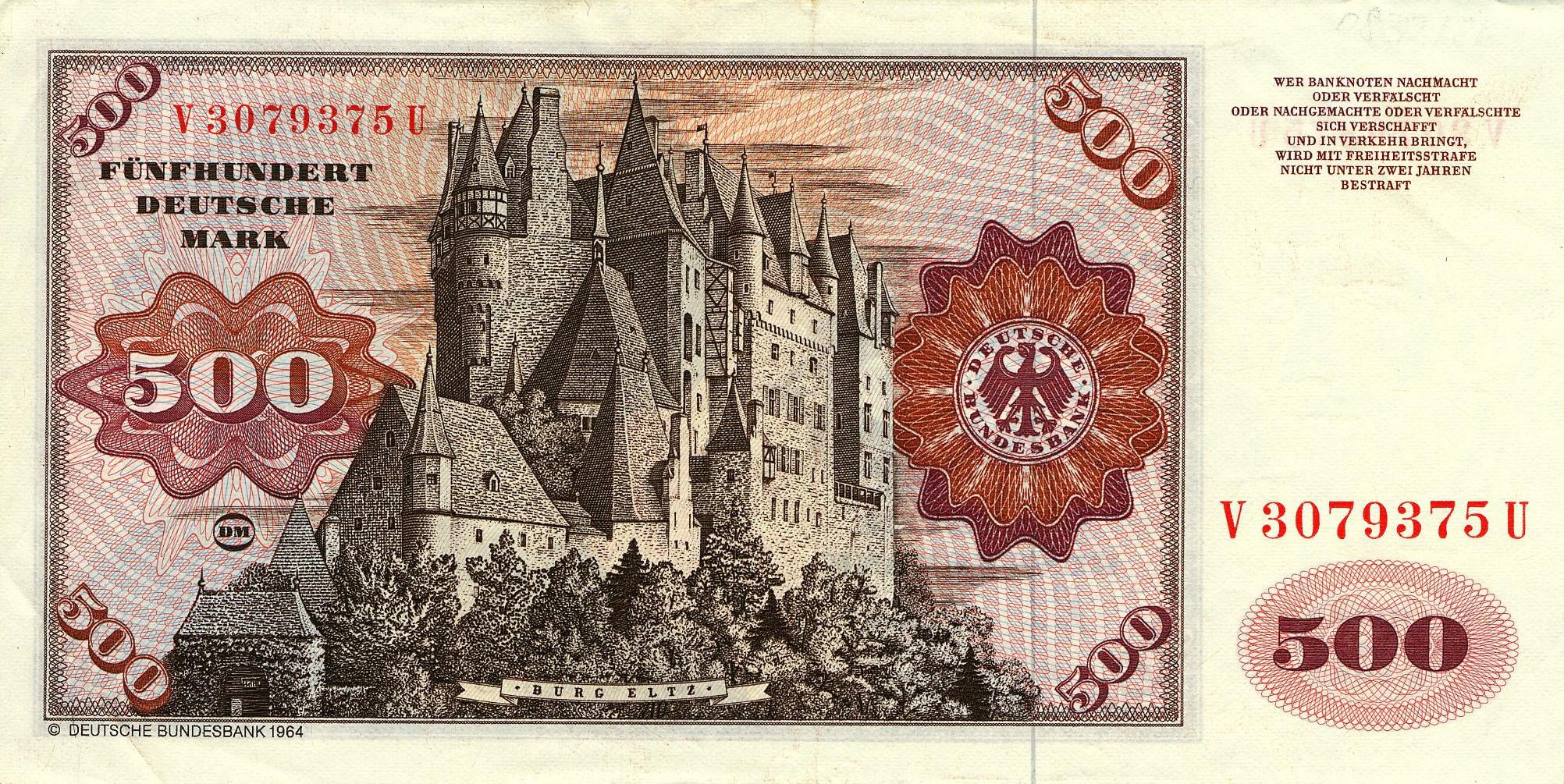
 Schwester Ernestine (Bild, in
Begleitung von deren Sohn, der so alt war wie Kohlrübchen), ihrer
Freundin Regine und deren Mann Berthold verabredet. Wir hatten
zusammen ein Bungalow 100 km südlich von Barcelona an der Küste
gemietet.
Schwester Ernestine (Bild, in
Begleitung von deren Sohn, der so alt war wie Kohlrübchen), ihrer
Freundin Regine und deren Mann Berthold verabredet. Wir hatten
zusammen ein Bungalow 100 km südlich von Barcelona an der Küste
gemietet. des Babys heftig angegriffen: wenn Steffi
(auf dem Bild links, neben Kohlrübchen) den Boden entlang
krabbelte, blutete sie aus dem After und eine feine Blutspur folgte
ihr. Ich war entsetzt. Wir überlegten, was zu tun sei. Spanien war
damals auf einem Entwicklungsstandard wie heute afrikanische Länder.
Hier eine kompetente medizinische Versorgung zu erwarten, schien
höchst vermessen. Andererseits: wo dann? In Südfrankreich? Ich war
skeptisch. Wir entschlossen uns, einen Versuch hier vor Ort zu
starten, um medizinische Hilfe zu bekommen. Gleichzeitig bereiteten
wir unseren Aufbruch vor – fast konnte man schon sagen: unsere
Flucht. Wir wollten so schnell wie möglich zurück in die
Zivilisation kommen. Nach den damaligen Verhältnissen – und
unseren Ansichten – war die nächste verlässliche Gegend die
Schweiz. Die war (auf Landstraßen) in 16 Stunden erreichbar.
des Babys heftig angegriffen: wenn Steffi
(auf dem Bild links, neben Kohlrübchen) den Boden entlang
krabbelte, blutete sie aus dem After und eine feine Blutspur folgte
ihr. Ich war entsetzt. Wir überlegten, was zu tun sei. Spanien war
damals auf einem Entwicklungsstandard wie heute afrikanische Länder.
Hier eine kompetente medizinische Versorgung zu erwarten, schien
höchst vermessen. Andererseits: wo dann? In Südfrankreich? Ich war
skeptisch. Wir entschlossen uns, einen Versuch hier vor Ort zu
starten, um medizinische Hilfe zu bekommen. Gleichzeitig bereiteten
wir unseren Aufbruch vor – fast konnte man schon sagen: unsere
Flucht. Wir wollten so schnell wie möglich zurück in die
Zivilisation kommen. Nach den damaligen Verhältnissen – und
unseren Ansichten – war die nächste verlässliche Gegend die
Schweiz. Die war (auf Landstraßen) in 16 Stunden erreichbar.
 erzählt. Die Wirtin wusste, dass es im
Ort ein Telefon gab. Die Besitzerin dieses Gerätes ließ von dort
alle Einwohner des Ortes telefonieren, d. h. sie vermittelte es,
Durchwahl gab es dort damals noch nicht, und diese Frau hatte wohl
eine Marktlücke entdeckt. Als wir ihr unser Problem erläuterten,
war sie begeistert. Ein Anruf nach Deutschland, welch eine
Herausforderung! Wie das geht, würde sie herausfinden! Wir sollten
zurück in die Wirtschaft gehen, sie würde uns informieren, wenn es
möglich sei. Nicht einmal zwei Stunden später schickte sie uns
eines ihrer Kinder vorbei: wir könnte jetzt kommen, sie hätte die
Freigabe einer Leitung für in 15 Minuten über die nationale
Postzentrale durchsetzen können. Das Foto
zeigt das Dorf der Telefonistin.
erzählt. Die Wirtin wusste, dass es im
Ort ein Telefon gab. Die Besitzerin dieses Gerätes ließ von dort
alle Einwohner des Ortes telefonieren, d. h. sie vermittelte es,
Durchwahl gab es dort damals noch nicht, und diese Frau hatte wohl
eine Marktlücke entdeckt. Als wir ihr unser Problem erläuterten,
war sie begeistert. Ein Anruf nach Deutschland, welch eine
Herausforderung! Wie das geht, würde sie herausfinden! Wir sollten
zurück in die Wirtschaft gehen, sie würde uns informieren, wenn es
möglich sei. Nicht einmal zwei Stunden später schickte sie uns
eines ihrer Kinder vorbei: wir könnte jetzt kommen, sie hätte die
Freigabe einer Leitung für in 15 Minuten über die nationale
Postzentrale durchsetzen können. Das Foto
zeigt das Dorf der Telefonistin. Der
Bodhisattva auf der linken Seite der untersten Stufe zwinkerte mir
zu, ermutigte mich. Es ging um den ersten Schritt, den ersten Schritt
auf der Leiter zur Vollkommenheit. Ich konzentrierte mich, wusste,
dass ich nicht durch die Kraft meiner Muskeln, sondern einzig durch
die meines Geistes weiter kommen würde. Und tatsächlich: meine Füße
standen still, aber durch die Kraft der meditativen Konzentration
wurde ich wie von Geisterhand – von der Hand meines konzentrierten
Geistes – dort hochgehoben. Ein beifälliges Raunen ging durch die
Versammlung der Bodhisattvas.
Der
Bodhisattva auf der linken Seite der untersten Stufe zwinkerte mir
zu, ermutigte mich. Es ging um den ersten Schritt, den ersten Schritt
auf der Leiter zur Vollkommenheit. Ich konzentrierte mich, wusste,
dass ich nicht durch die Kraft meiner Muskeln, sondern einzig durch
die meines Geistes weiter kommen würde. Und tatsächlich: meine Füße
standen still, aber durch die Kraft der meditativen Konzentration
wurde ich wie von Geisterhand – von der Hand meines konzentrierten
Geistes – dort hochgehoben. Ein beifälliges Raunen ging durch die
Versammlung der Bodhisattvas. Bodhisattvas raunten, ob ich denn auch den zweiten
Schritt schaffen würde…
Bodhisattvas raunten, ob ich denn auch den zweiten
Schritt schaffen würde…